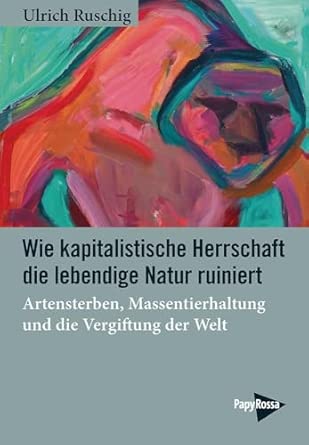
Die Theoreme heutiger Naturwissenschaften sind für einen Laien kaum zu verstehen. Ist einer naturwissenschaftlich ausgebildet und betreibt kenntnisreich Philosophie, muss er bald als ein Exot gelten. Dieser Autor hat seine Ausbildung als Biochemiker erfahren, ist später Hochschullehrer für Philosophie geworden, und Berührungsangst mit politisch-praktischer Tätigkeit ist ihm fremd. Er schreibt in diesem Buch über Descartes, Spinoza und Fichte. Er schreibt über sie in einer Weise, die man in keinem Philosophielehrbuch und keinem Wikipediaartikel findet. Er macht sie mitverantwortlich für die „allenthalben zu beobachtenden Grausamkeiten gegenüber den Tieren.“
In dem Buch geht es ständig hin und her: Es handelt von den philosophischen Spekulationen der Aufklärer im Vorfeld der bürgerlichen Gesellschaft; dann gibt es wieder, was das gegenwärtige Stadium dieser Gesellschaft an Nachrichten produziert. Es sind die unter Vermischtes zu lesenden Nachrichten. Eine vom 20. Februar 2024 ging etwa so:
Im südafrikanischen Kapstadt liegt ein widerlicher Geruch aus Fäkalien und Ammoniak über dem Hafen. Die Behörden vermuten eine defekte Abwasserleitung, bis sie, von Tierschützern aufmerksam gemacht, auf ein brasilianisches Containerschiff stoßen. Der Frachter hat Rinder an Bord. 100? 1.000? Nein,19.000. Sie sind in Boxen eingesperrt und die Boxen stapeln sich über neun Stockwerke. Die Fahrt geht über zwei Wochen. Der Stopp in Südafrika war notwendig, um Diesel und Tierfutter zu laden. Die Tiere stehen oder liegen in ihren Exkrementen bis ihre letzte Reise irgendwo auf der Welt zu Ende geht.
Ruschig verweist auf Descartes: Der vergleicht die Tierseele mit dem Inneren einer von Zugfedern und kleinen Zahnrädern bewegten Uhr. Dann zitiert er Fichte, dessen absolut genanntes Ich die ganze, Nicht-Ich genannte Welt aus sich herausspinnt. Über den von diesem Idealismus beseelten Menschen heißt es: „In seinem Dunstkreise wird die Luft sanfter, das Klima milder, und die Natur erheitert sich durch die Erwartung, von ihm in einen Wohnplatz und in eine Pflegerin lebender Wesen umgewandelt zu werden.“ Was uns Gegenwärtigen, den von den ökologischen Krisen Gehärteten, wie ein Hohn klingt, war das der bürgerlichen Gesellschaft an ihrer Wiege gesungene Lied. Aber wenigstens spricht doch Spinozas Pantheismus der tierischen Natur ihr Recht zu, oder? Weit gefehlt. Die Tiere haben zwar Empfindungen, aber aus diesen Empfindungen folgt kein Recht: „…wohl aber verneine ich, daß es deswegen nicht erlaubt sein soll,… sie nach Belieben zu gebrauchen und so zu behandeln, wie es uns am besten paßt, da sie ja der Natur nach nicht mit uns übereinstimmen…“
Ein Ensemble von Arten
Ulrich Ruschigs Buch ist gegen diese Weltauffassung gerichtet. Er schreibt damit gegen die ganze nachmetaphysisch gerichtete Philosophie an. Den Diskurstheoretikern, den Neo-Pragmatisten, den auf den Neukantianismus zurückgehenden analytischen Philosophen ist gemeinsam, dass sie die externe Natur für substanzlos erklärten. Mit dem Spinozismus, schwerlich ihr philosophischer Referenzpunkt, stimmen sie darin überein, denn auch für Spinoza ist die Natur substanzlos, nur ein Modus des göttlichen Seins.
Der Begriff der Substanz verweist auf den hinter den sinnlich wahrnehmbaren Naturdingen liegende Grund, dem diese ihr Sein verdanken. Diesen Grund gäbe es gar nicht, die Naturdinge seien Ursache ihrer selbst und den physikalischen Wissenschaften komme das Vermögen zu, die Natur, und in the long run die gesamte Natur in ihrer Genese, restlos zu begreifen. Sie in eine Erscheinung für uns und in ein diese Erscheinung begründendes An sich-Sein zu scheiden, sei ein metaphysisches Dogma und wie die gesamte Metaphysik widerlegt. Die Systemtheorie, die Kategorien Grund und Begründetes durch das Begriffspaar System und Umwelt ersetzend, ist die ideengeschichtlich letzte Attacke wider die für unwissenschaftlich deklarierte Metaphysik.
Der Biologe in Ruschig macht sich daran, diesen Vorwurf rumzudrehen. Dann ist der das wissenschaftliche Erkenntnisvermögen zur Philosophie adelnde Positivismus dogmatisch und die Metaphysik rehabilitiert. Die für sein Buch zentralen Passagen finden sich in dem der modernen Biologie gewidmeten Kapitel. Der biologische Artbegriff reicht nicht hin, solange er nur szientivisch erfassbare Prädikate wie Energie und Materie in sich aufnimmt, lesen wir. Im 20. Jahrhundert habe sich ein Artbegriff belebter Natur durchgesetzt, der ideell gefasst sei. Dass jede Tierart nur im Ensemble, in Populationen leben und überleben könne, sei ein ideelles, also nicht dinghaft und als Naturgesetz festzumachendes Faktum. Die ganze externe lebendige Natur existiere nur als ein Ensemble von Arten. Das Ansich-Sein der Natur klingt an, diesmal von physikalisch-biologischer Seite.
Was eine Art ausmacht, ist keine Erscheinung in Raum und Zeit, „kein Gegenstand möglicher Erfahrung“, wie Ruschig mit Kants Worten schreibt. Was keine beobachtbare Realität aufweist, dem kommt, hält man sich an das Kriterium der nachmetaphysischen Philosophie, keine Realität zu. Aber das metaphysisch-ontologischen Moment weist Realität auf – wenn auch eine massiv bedrohte.
Ruschig hat sein Buch als eine politische Aufklärungsschrift verfasst. Mit den philosophischen Begriffen geht er sehr sparsam um. Er übersetzt sie in die dem Alltagsverstand zugängliche Erfahrungs- und Denkweise. Der Common Sense kann sehr wohl verstehen, was mit dem Begriff des nicht wahrnehmbaren, gleichwohl existenten Allgemeinen thematisch ist: Stirbt das letzte Exemplar seiner Art (wie bald wohl der Feldhamster), ist nicht nur ein Individuum tot, sondern eine Entität. Es verschwindet ein mit physikalischen Parametern nicht erfassbares Sein, das es einmal gegeben hat und nun nicht mehr gibt.
Politische Ökonomie und literarische Romantik
Das Buch handelt von dem auf Koexistenz verwiesenen Leben der Tiere und Menschen, also von Ökosystemen. (Ein Wort, das man bald nicht mehr hören kann, bewirbt doch schon jede Bank ihre Palette an Dienstleistungen mit diesem Wort). Dass diese Systeme ramponiert sind, weiß jeder Nachrichtenkonsument. Was diese Verheerung verursacht, darüber herrscht große Ratlosigkeit. Für eine Erklärung bleiben die Medienmärkte gesperrt: Das ökonomische System darf als der Schuldige nie ausgemacht werden. Gegen diese Nachrichtensperre schreibt Ruschig an. Das Kapital, heißt es in dem von ihm zitierten gleichnamigen Buch, ist ein „Fanatiker der Verwertung des Werts.“ Dem Profitprinzip unterworfen, kennt es keinen Halt, muss es die Produktion und die Konsumtion zum Schaden der Natur immerfort ausweiten. Ruschigs Protest speist sich aus der reifsten, politisch-ökonomischen Form der Kritik wie aus der frühesten, literarischen, der Romantik. Dann liest man solche Sätze: „Wertlos ist das Leben der Insekten geworden, insbesondere der Schmetterlinge…“
Er modifiziert die auf marxistische Autoren zurückgehende Zusammenbruchtheorie. Wenn die kapitalistische Produktionsweise „nur noch kurze Zeit andauern wird“, kollabiere nicht diese Produktionsweise selbst, sondern große Teil der uns umgebenden Biosphäre. Die ökonomische Zusammenbruchtheorie stand immer auf wackeligen Beinen; die ökologisch modifizierte findet im massenhaften Verschwinden der Tier- und Pflanzenarten ihre traurige Bestätigung. Ruschig greift auf Dokumente eines Weltbiodiversitätsrats zurück. Demnach verschwinden weltweit pro Jahr etwa 55.000 Arten. Seit die große Industrie die dem Kapital adäquate Produktionsweise geworden ist, seit etwa 200 Jahren also, sind 80 Prozent der einmal vorhandenen Vögel verschwunden („Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Vögel„).

Alle Vögel sind schon da, heißt es in einem alten Kinderlied und: Was sie uns erzählen nun, nehmen wir zu Herzen. Ruschig nimmt sich diese Erzählung des Verschwindens wahrlich zu Herzen. Ihm sind die Tiere keine „seelenlose Ansammlung von Molekülen.“ Er reformuliert den Kantischen Kategorischen Imperativ: Da menschliches Leben, wie jedes andere auch, nur möglich sei in einem Ensemble von Tier- und Pflanzenarten, sei es vernunftgemäß, das Leben dieses Ensembles zu achten, „i. e. leben zu lassen.“ Man muss genau lesen: „Also ist es moralisch geboten, die in Arten lebenden Lebewesen als diese Arten zu respektieren und gerade nicht dem einen abstrakten Zweck der Kapitalvermehrung die Eigentümlichkeit der spezifischen Arten zu opfern…“ Liest man genau, bleibt eine Unklarheit: Ist es moralisch geboten, die Arten vor dem Aussterben zu bewahren, oder verstößt schon das Töten eines Tierindividuums geben das Gebot?
Der äußeren Natur kommt kein Selbstbewusstsein zu, hält Ruschig einerseits fest, und Selbstbewusstsein gilt ihm als gleichbedeutend mit menschlicher Subjektivität. An anderer Stelle spricht er der Natur eine eigene Subjektivität zu. Wären die Menschen einmal vom Alp ihres verkehrten Produktionsprinzips befreit, wäre auch die Natur befreit. Die befreite Natur – das ruft ein Bild der Versöhnung nach dem Ende aller Tage auf. An der theologischen Grundierung des Bildes haben sich Bloch, Benjamin und Marcuse nicht gestört. Ruschig schließt sich ihnen an. Der nicht leicht zu widerlegende Einwand: Eine befreite Gesellschaft könne wohl die unbeherrschte Naturzerstörung des Kapitalismus beenden, aber auf die Aneignung der äußeren Natur, auf ihre Beherrschung im Produktionsprozess, könne auch sie nicht verzichten.
Ulrich Ruschig: Wie kapitalistische Herrschaft die lebendige Natur zerstört.
Verlag Papyrossa, 2025, 192 Seiten, 19,18€
